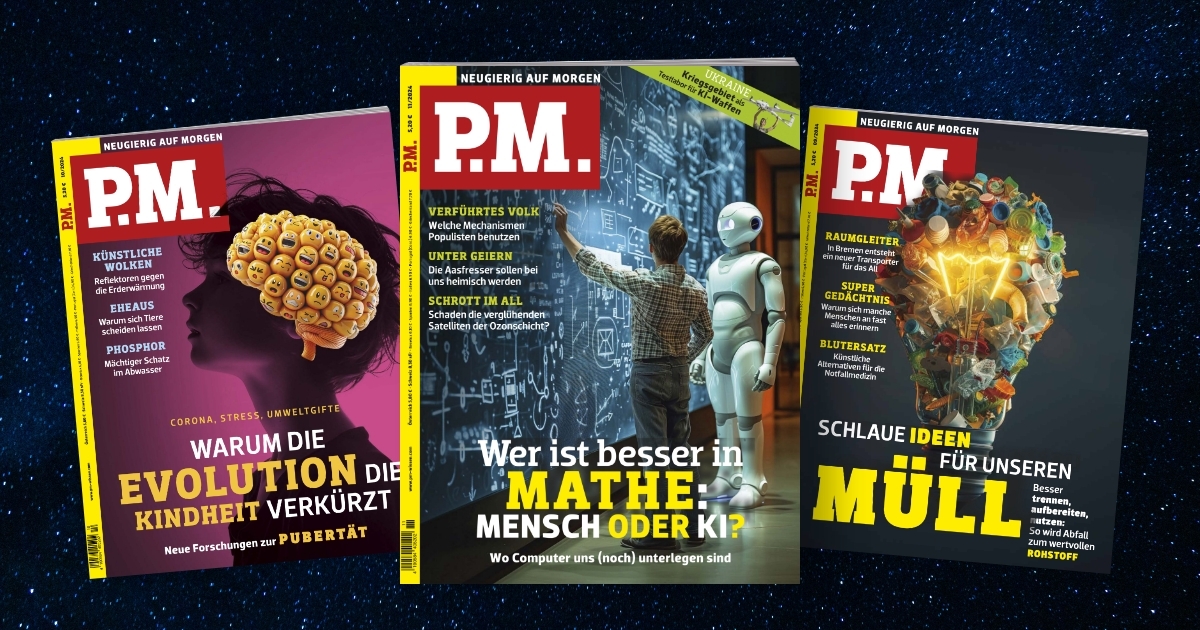TEXT: CAROLINE RING
Die Stimme der Tierpflegerin überschlägt sich, als sie die hellen Schatten auf dem Ultraschall entdeckt. »Ein Junges!« Charlotte, die Kalifornische Rundstechrochen-Dame, ist schwanger! Im kleinen Aquarium von Hendersonville im US-Bundesstaat North Carolina ist die Aufregung so groß, dass man den Moment für ein Instagram-Video filmt.
Schon vor einiger Zeit war dem Personal jener merkwürdige Buckel aufgefallen, den Charlotte neuerdings auf dem Rücken trug. Die Untersuchung Anfang Februar 2024 schließlich brachte Gewissheit – und ein großes Fragezeichen. Denn in dem Aquarium gibt es nur einen Rochen: Charlotte. Einem Männchen begegnete sie zuletzt vor acht Jahren, viel zu lange her für eine Paarung.
Wie also konnte sie schwanger werden? Jungfernzeugung heißt das Phänomen, benannt nach der biblischen Jungfrau Maria, oder auch Parthenogenese: Ein Weibchen erwartet wie aus dem Nichts Nachwuchs. Keine Paarung, kein Sex, kein Männchen weit und breit. Charlotte ist nicht die Einzige mit dieser wunderlichen Entwicklung. Echsen machen es, Blattläuse, Wespen, Fische, sogar manche Vögel: Rund 100 Tierarten sind bekannt, bei denen Parthenogenese möglich ist.
Dennoch erregt es jedes Mal Aufsehen, wenn das Phänomen auftritt: Viele Fälle wurden bei Tieren beobachtet, die in Zoos oder Aquarien gehalten werden, bei denen man sich sicher sein kann, dass sie seit Jahren keinen Kontakt zu Männchen hatten – wie Charlotte.
Im Juni 2023 etwa wurde erstmals Parthenogenese bei einem Krokodil beschrieben. Das Tier lebte seit 16 Jahren isoliert in einem Zoo in Costa Rica, wo es hin und wieder Eier legte. Ein nicht ungewöhnlicher Vorgang bei Reptilien, die in Gefangenschaft gehalten werden. Diesmal jedoch enthielt eines der Eier ein vollentwickeltes Babykrokodil. Es schlüpfte nicht, doch sein Genom stimmte zu 99,9 Prozent mit dem der Mutter überein.
Glücklicher endete 2014 die Geschichte der Netzpython Thelma. Elf Jahre alt war sie da, sie lebte in einem Zoo im US-Bundesstaat Kentucky. Noch nie in ihrem Leben war sie zu diesem Zeitpunkt mit einer männlichen Netzpython zusammen gewesen, lediglich mit einem anderen Weibchen teilte sie ihr Terrarium. Doch aus den Eiern schlüpften tatsächlich kleine Schlangen. Drei von ihnen waren exakt wie die Mutter gefärbt, die anderen drei zeigten ein anderes Muster – obwohl es sich auch bei ihnen um genetische Klone handelte.
Ungünstige Umweltbedingungen fördern die Parthenogenese, so nehmen die Forscherinnen und Forscher an. Bei Arten, die sich auch sexuell vermehren können – etwa Stechrochen, Krokodil und Netzpython –, wird dann eine Art Notprogramm in Gang gesetzt. Dessen Grundlagen werden erst seit Kurzem entschlüsselt. 2023 wurde erstmals ein Gen für Parthenogenese entdeckt, bei Fruchtfliegen der Art Drosophila melanogaster. Auch diese Insekten vermehren sich üblicherweise durch die Paarung. Wissenschaftler setzten dem Genom der Tiere Gene einer nah verwandten Art ein, bei der häufig Parthenogenese auftritt – und konnten so die Abschnitte identifizieren, die eine ungeschlechtliche Fortpflanzung ermöglichen.
Diese Erkenntnis könnte dabei helfen, auch bei anderen Arten ähnliche Gene zu identifizieren. Vielleicht ließe sich der Prozess dann eines Tages sogar im Labor kontrollieren. Es gibt jedoch auch Arten, für die diese Art der Fortpflanzung normal ist. Blattläuse etwa: Sie bringen nur einmal im Jahr Männchen hervor, sodass sich nur jede 20. Generation geschlechtlich vermehrt.
Noch radikaler sind die Geschlechtsverhältnisse beim Amazonenkärpfling, einem wenige Zentimeter langen, silbrig-grauen Fisch. Ursprünglich nur in Mittelamerika beheimatet, findet man ihn mittlerweile auch in vielen Laboren. Sein Name leitet sich vom sagenhaften, rein weiblichen Stamm der Amazonen ab: Auch alle Amazonenkärpflinge sind weiblich. Das stellten Forscher 1932 fest – und mit dieser Erkenntnis war der erste Organismus gefunden, bei dem Parthenogenese als natürliche und einzige Fortpflanzungsmethode existierte.
JUNGFERNZEUGUNG HEISST DAS PHÄNOMEN, BENANNT NACH DER BIBLISCHEN JUNGFRAU MARIA
Mittlerweile ist bekannt, dass die Fische durchaus unterschiedliche Charaktereigenschaften ausbilden – obwohl sie genetische Klone ihrer Mütter sind und auch, wenn sie unter identischen Lebensbedingungen gehalten werden. Und man weiß, dass der Amazonenkärpfling trotz allem nicht ohne Männchen auskommt. Für seine Vermehrung ist er auf die Existenz nah verwandter Arten angewiesen. Nur wenn deren Männchen Sperma zur Befruchtung ins Wasser abgeben, wird auch die Eientwicklung beim Amazonenkärpfling angeregt. Genetischen Einfluss haben die Spermien nicht.
»Der große Vorteil bei der Parthenogenese ist, dass alle Individuen Nachkommen erzeugen können«, erklärt Manfred Schartl, Professor am Lehrstuhl für Entwicklungsbiochemie an der Universität Würzburg. »Die Vermehrungsrate einer Population ist dadurch schneller als bei Arten, die Männchen und Weibchen produzieren müssen.« Schartl studiert mit seinem Team den Amazonenkärpfling und will herausfinden, wie die Parthenogenese bei dem Fisch auf molekularer Ebene abläuft. Denn eigentlich hat das Phänomen einen gewaltigen evolutionären Nachteil: Wenn sich bei der Erzeugung eines Individuums unterschiedliche Genome nicht durchmischen, steigt die Anfälligkeit für Krankheiten, Missbildungen oder Unfruchtbarkeit stark an. Das zeigt nicht zuletzt die Erforschung von künstlich hergestellten Klonen.
Auch Jungtiere, die durch Parthenogenese entstehen, sterben häufig früh, werden mit Erbkrankheiten geboren oder schlüpfen erst gar nicht. Entsprechend geringe Chancen haben sie, sich selbst fortzupflanzen. Doch dem Amazonenkärpfling scheinen all diese Nachteile nichts auszumachen: Kommt er in einem Gewässer vor, so gibt es dort von ihm gleich mehrere Tausend.
»Wir wissen, dass der Amazonenkärpfling als Art vor über 100 000 Jahren entstand«, sagt Schartl. Damals kreuzten sich zwei Arten von Kärpflingen – ein Vorgang, der eigentlich unmöglich ist. Doch in diesem Fall brachte die Verbindung einen überlebensfähigen Hybriden hervor, der auch noch zur Parthenogenese fähig war. »Prima Eva« heißt dieser erste Amazonenkärpfling unter Fachleuten.
Schartl und sein Team konnten feststellen, dass mittlerweile in der Wildnis nicht nur eine mütterliche Linie existiert, sondern mehrere genetisch unterschiedliche Klone. Wie sie entstanden, wo es doch keine Männchen gibt, ist unklar: Vielleicht sind im Laufe der Zeit zufällige Mutationen aufgetreten. Vielleicht spielte aber auch das Sperma anderer Kärpflingsarten eine Rolle, weil es einen (womöglich chemischen) Kontaktreiz liefert, der die parthenogenetische Entwicklung auslöst. Aber die Frage bleibt: Wie sind die Fische dem Aussterben entgangen?
JUNGTIERE, DIE DURCH PARTHENOGENESE ENTSTEHEN, STERBEN HÄUFIG FRÜH ODER SCHLÜPFEN ERST GAR NICHT
Die Antwort darauf bedeute weit mehr als die Entschlüsselung einer biologischen Skurrilität, so Schartl: »Dahinter steht auch die Frage aller Fragen: Warum gibt es überhaupt die zweigeschlechtliche Sexualität? Und warum ist sie die weitaus häufigste Art der Fortpflanzung?« Schließlich kostet die geschlechtliche Vermehrung viele Ressourcen, viel Energie. Die Parthenogenese-Arten aber führen vor, dass es auch einfacher geht.
Bei allen zweigeschlechtlichen Arten gibt es einen Vorgang im Körper, der das Durchmischen der Genome vorbereitet: die Meiose. Das ist eine Form der Zellteilung, die ausschließlich in den Keimdrüsen stattfindet – bei Menschen sind das Hoden und Eierstöcke. Dabei verändert sich auch die Erbinformation: Normalerweise enthält jede Körperzelle einen doppelten Chromosomensatz. Jedes Chromosomen bündelt auf spezielle Weise alle Erbinformationen eines Lebewesens. Bei einer normalen Zellteilung wird der doppelte Chromosomensatz zunächst vereinfacht und anschließend in den neuen Zellen verdoppelt. Bei der Meiose folgt nach der Teilung ein zusätzlicher Schritt, durch den der einfache Chromosomensatz noch einmal geteilt wird. Keimzellen enthalten daher nur einen halben Chromosomensatz. Wenn diese Keimzellen – Spermium und Eizelle – verschmelzen, entsteht ein neuer, einfacher Chromosomensatz. Daraus kann ein neuer Organismus erwachsen. Sein Genom enthält damit Erbinformationen von Mutter und Vater.
Im Amazonenkärpfling findet dagegen keine Meiose statt. Jede Eizelle trägt bereits einen doppelten Chromosomensatz in sich. Warum? Das wissen Biologen bislang nicht. Eine andere Variante der Parthenogenese bei Tieren können Fachleute mittlerweile besser rekonstruieren: die Automixis. Dabei befruchtet sich die Eizelle eines Weibchens selbst – mithilfe eines sogenannten Polkörperchens.
Das ist ein Nebenprodukt der Eizellproduktion, von dem bei der Meiose drei Stück entstehen. Die Polkörperchen werden normalerweise abgebaut oder ausgestoßen. Doch sie enthalten, wie jedes Meiose-Produkt, einen halben Chromosomensatz – so viel also, wie es für eine Zeugung braucht. Auch wenn das Polkörperchen den gleichen Chromosomensatz enthält wie die Eizelle – es wird zum Ersatzspermium und verschmilzt mit der Zelle. Im Wortsinn befruchtet sich das Weibchen selbst.
Automixis wurde 2017 etwa bei zwei Zebrahai-Weibchen in einem australischen Aquarium nachgewiesen: Die Art kann sich sowohl sexuell als auch durch Parthenogenese vermehren. Obwohl die beiden Weibchen keinen Kontakt zu Männchen hatten, legten sie Eier, aus denen gesunde Nachkommen schlüpften – dank ihrer Polkörperchen.
Teste das P.M. Schneller Schlau Magazin und spare 50 Prozent!
Auch beim Kalifornischen Kondor vermuten Biologen Automixis hinter zwei Fällen von Parthenogenese. 2021 berichteten sie von den Tieren: Sie waren im Rahmen eines Zuchtprogramms geschlüpft. Die Züchtung ist dringend nötig, denn der Vogel ist vom Aussterben bedroht. Anfang der 1980er-Jahre existierten nur noch 22 Exemplare in der Wildnis. Heute sind es wieder mehrere Hundert, doch um Nachteile durch Inzucht so gering wie möglich zu halten, werden die Tiere genetisch analysiert. Dabei fiel zufällig auf, dass zwei Individuen durch Parthenogenese entstanden sein müssen. Ein Glücksfall: Die Vorteile der Parthenogenese haben schließlich dazu geführt, dass die Zahl der Vögel rascher anwachsen konnte.
Und Stechrochen Charlotte? Die gleitet weiterhin durch ihr Aquarium in Hendersonville. Das Video ihrer Ultraschall-Untersuchung hat mittlerweile knapp drei Millionen Aufrufe. Anfangs hieß es noch, man erwarte den Nachwuchs in wenigen Wochen. Später dann: Die übliche Tragezeit von Charlottes Art liege bei drei bis vier Monaten. Mittlerweile herrscht Sorge, mit dem Rochen stimme etwas nicht, die Schwangerschaft dauere viel zu lange. Doch das Ultraschallbild ist da, genauso wie Charlottes unübersehbarer Buckel. Ihr Betreuer-Team postet regelmäßig Charlotte-Updates in den sozialen Medien. Der Inhalt ist stets ähnlich: Charlotte gehe es gut. Sie frisst Muschelfleisch und zieht friedlich ihre Bahnen.
Wie haben Tiere Sex? So aufregend ist tierisches Sexleben | Monogame Tiere: Ein Blick in die Welt der treuen Tierarten | Fortpflanzung in der Tierwelt |