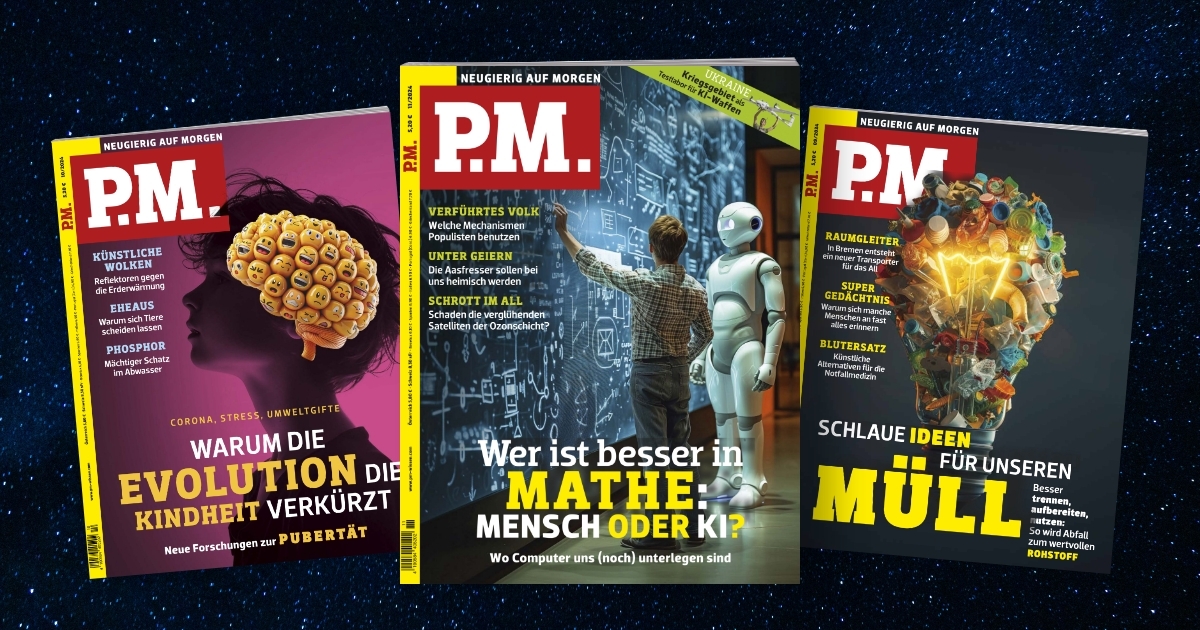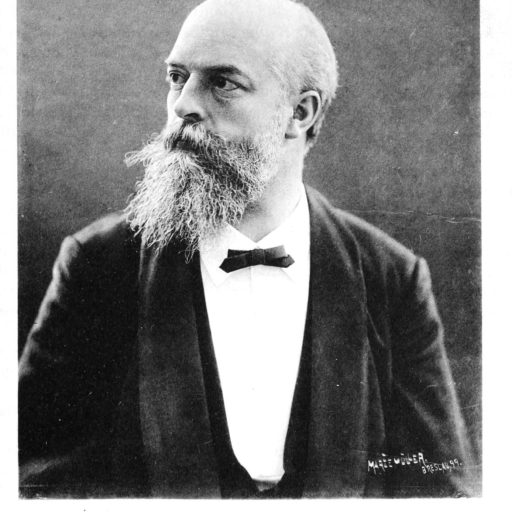Schulnoten: Woher kommt die gefürchtete „Sechs“?
Das änderte sich mit der schrittweisen Einführung einer allgemeinen Schulpflicht zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. Um 1850 etablierte sich etwa in Preußen eine dreistufige Bewertungsskala, die auf vier und später fünf Stufen erweitert wurde. Die gefürchtete „Sechs“ kam 1938 im Dritten Reich dazu, wohl aus einem statistischen Grund: Bei einer fünfstufigen Skala – so die Theorie – tendieren Lehrer oft zur mittleren Note. Und die gibt es bei sechs Ziffern nicht.
Mit der Einführung der Schulpflicht und der Etablierung einer genormten Bewertungsskala erhielten Schulnoten eine immer größere Bedeutung für den Bildungs- und Berufsweg der Schüler. Diese Noten wurden zunehmend standardisiert, um ein objektives Kriterium für die Beurteilung von Schülerleistungen zu schaffen. So wurden Noten für Prüfungen, Hausaufgaben und mündliche Beiträge festgelegt. Mit der Zeit entwickelten sich die schulischen Bewertungssysteme weiter und passten sich den unterschiedlichen Bildungssystemen und -anforderungen an. Heute sind Schulnoten ein wesentlicher Bestandteil des Bildungssystems weltweit und dienen nicht nur als Rückmeldung für Schüler und Eltern, sondern auch als Selektionskriterium für weiterführende Bildungseinrichtungen und Arbeitgeber. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Noten – trotz aller Kritik an ihrer Objektivität und Aussagekraft – nach wie vor eine zentrale Rolle im schulischen und beruflichen Leben spielen.